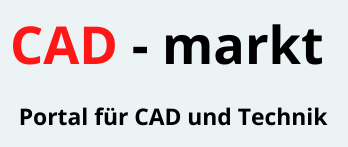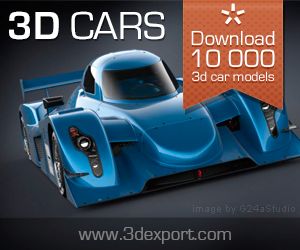Technische Visualisierung für Ausschreibungen: Wie Bilder Entscheidungen beschleunigen
Ob im Hochbau, im Anlagenbau oder dem Maschinenbau – öffentliche und private Ausschreibungen folgen heute klaren Kriterien. Neben der fachlichen Eignung und der Kostenstruktur gewinnen dabei zunehmend auch visuelle Darstellungen an Bedeutung.
Gerade bei komplexen technischen Projekten reicht eine textliche Beschreibung häufig nicht aus, um die Entscheider von einer Lösung zu überzeugen. Technische Visualisierungen, egal ob in Form von Renderings, Animationen oder 3D-Modellen, machen an diesem Punkt einen entscheidenden Unterschied.
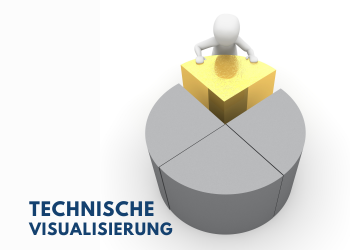
Visuelle Informationen prägen sich besser ein
Bei dem Trend zu visuellen Inhalten handelt es sich allerdings um keinen Zufall. Eine internationale Studie der Universität Stanford belegt, dass bildhafte Informationen im Schnitt um 65 Prozent besser behalten werden als rein textbasierte.
Auf Seite der Auftraggeber bedeutet das, dass Anbieter mit anschaulichen Darstellungen bereits im ersten Auswahlprozess einen bleibenderen Eindruck hinterlassen. Die Kombination aus Präzision, Verständlichkeit und emotionaler Ansprache spricht sowohl Fachgremien als auch nicht-technische Entscheidungsträger an.
In diesem Kontext arbeiten viele Unternehmen mittlerweile eng mit einer professionellen 3D Agentur zusammen, die komplexe technische Sachverhalte anschaulich und zugleich normgerecht abbildet. Der Fokus liegt dabei nicht auf einer künstlerischen Darstellung, sondern auf der präzisen Kommunikation technischer Inhalte – von Bauteilgeometrien über Montageabfolgen bis hin zu Funktionsprinzipien.
Technische Visualisierung im Vergabeprozess: Wo sie zum Einsatz kommt
Technische Visualisierungen kommen in unterschiedlichen Phasen der Ausschreibung zum Einsatz. Bereits in der Angebotsphase dienen sie dazu, das vorgeschlagene Konzept verständlich zu vermitteln. In Architekturwettbewerben sind 3D-Renderings mittlerweile Standard. Doch auch in industriellen Ausschreibungen nimmt ihr Stellenwert stetig zu, zum Beispiel beim Bau von Fertigungsstraßen, der Konstruktion von Sondermaschinen oder in Infrastrukturprojekten wie Brücken oder Tunneln.
Oftmals fordern die Vergabestellen nicht explizit Visualisierungen an. Dennoch werden Angebote mit anschaulichen Darstellungen häufiger als „besser aufbereitet“ bewertet. Entscheidend ist dafür allerdings die Qualität: Technische Korrektheit, Maßhaltigkeit und kontextbezogene Darstellung − beispielsweise durch Einbettung in Bestandsbauwerke oder Abläufe − spielen eine zentrale Rolle.
Überzeugende Vorteile für Auftraggeber und Anbieter
Für Auftraggeber bedeuten Visualisierungen mehr Transparenz im Entscheidungsprozess. Sie ermöglichen einen realistischen Eindruck von den Lösungsansätzen − insbesondere wenn mehrere Angebote miteinander verglichen werden müssen. So lassen sich bereits vor der Umsetzung eventuelle Schwachstellen erkennen oder Missverständnisse vermeiden. Die Anbieter profitieren auf der anderen Seite davon, dass ihre Ideen nicht im Kleingedruckten untergehen. Gut gemachte Visualisierungen lenken die Aufmerksamkeit auf die Qualität der technischen Lösung, auf Besonderheiten im Aufbau oder auf innovative Ansätze. Gerade bei komplexen, schwer beschreibbaren Leistungen ist dies ausschlaggebend.
Ein weiterer Vorteil liegt in der interdisziplinären Verständlichkeit. Technische Planer, Betriebswirte und Projektverantwortliche mit unterschiedlichem Hintergrund können sich auf Basis der Visualisierungen schneller ein gemeinsames Bild machen. Dies stellt eine nicht zu unterschätzende Hilfe bei Gremienentscheidungen dar.
Welche Formate sich bewährt haben
Die Bandbreite an Visualisierungsformaten ist heute groß. Klassische 3D-Renderings sind weit verbreitet und bieten eine realitätsnahe Darstellung von Produkten, Anlagen oder Baukörpern. Animierte Sequenzen kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn Bewegungsabläufe, Montagevorgänge oder Funktionsprinzipien nachvollziehbar gemacht werden sollen.
Interaktive 3D-Modelle bieten daneben einen besonders hohen Informationswert. Sie ermöglichen es den Betrachtern, Objekte aus verschiedenen Perspektiven anzuschauen oder bestimmte Bauteile ein- und auszublenden. Immer häufiger werden solche Modelle auch browserbasiert bereitgestellt – ein großer Vorteil in Zeiten verteilter Projektteams. Zunehmend gewinnen in diesem Kontext ebenfalls AR- und VR-Anwendungen an Bedeutung. Während Virtual Reality für immersive Präsentationen in frühen Planungsphasen genutzt wird, eignen sich AR-Anwendungen besonders zur Verknüpfung von Planungsdaten mit der realen Umgebung, etwa bei der Überlagerung geplanter Anlagen auf bestehende Werkslayouts.